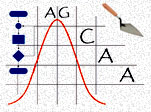Computeranwendungen &
Quantitative Methoden in der Archäologie
|

|
3. Workshop der
AG CAA
20.–21.1.2012
Bamberg
|
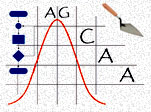
|
Die AG Computeranwendungen
und Quantitative Methoden in der Archäologie e.V.
und das Institut für
Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg haben am 20.–21. Januar
2012 der an Universität
Bamberg den 3. CAA-Workshop veranstaltet. Wie in den Vorjahren trafen sich
Vertreter verschiedener Disziplinen, die sich mit
Computeranwendungen und quantitativen Methoden in der
Archäologie beschäftigen, die Möglichkeit geben,
um über laufende Forschungsprojekte oder Abschlussarbeiten
zu berichten sowie über die Möglichkeiten und Grenzen
verschiedener Methoden zu diskutieren.
Im Anschluss wurden in Computerpools
der Universität zwei Softwaretutorials
angeboten, dieses mal Einführungen in die Programme R (Statistik)
und gvSIG (GIS).
Nach den beiden voran gegangenen
Veranstaltungen in Bonn (2010) und Mainz (2011) erfreute sich
auch der Bamberger Workshop einer erfreulich hohen Besucherzahl
(ca. 100) und war geprägt von einer angeregten
Diskussionsatmosphäre.
Einige der Vorträge fanden
Berücksichtigung in einem Artikel über "Computer in
der Archäologie" der führenden Computerfachzeitschrift
c't (H.-A. Marsiske, Jäger der verlorenen Daten. Mit
Digitaltechnik auf den Spuren der Vergangenheit. c't 2012/5,
80-83), den sie hier als
Scan herunter laden können.
Vorläufiges
Programm:
Poster
Vorträge:
Mit Hightech ins Bergwerk. Nicht-invasive Untersuchungen des
römischen Goldbergreviers Três Minas (Nordportugal) mit
Hilfe eines terrestrischen 3D-Laserscanners
Markus Helfert, Britta Ramminger, Regula Wahl-Clerici
Das heute als
Bodendenkmal geschützte römische Goldbergwerk Três
Minas bei Pouca de Aguiar in Nordportugal zählt aufgrund der
fast vollständig erhaltenen Geländedenkmäler zu den
bedeutendsten Beispielen der Goldgewinnung im gesamten
Römischen Reich. Die reichhaltigen Gold- und Silbererze
wurden vom ersten bis dritten Jahrhundert nach Christus im
Tagebauverfahren sowie im Schachtbau gewonnen. Neben dem Abbau von
Gold und Silber erfolgte auch eine Gewinnung von Kupfer und Blei,
wodurch unter Anleitung römischer Ingenieure eine Bergkuppe
nahezu komplett abgetragen wurde. Dabei entstanden zwei bis zu 120
m tiefe Erzpingen, die heute wie Krater in der Landschaft liegen.
Weitere Denkmäler bezeugen die bergbaulichen Prozesse Abbau,
Förderung und Aufbereitung. Hinzu kommen eine ausgedehnte
Bergwerkssiedlung und ein Wasserleitungssystem mit einer
Länge von 230 km. Besonders dieses spektakuläre
hydraulische Abbauverfahren beeindruckte bereits Plinius den
Älteren, der dieses den Werken von Giganten gleichsetzte.
Zu den
bekanntesten Überresten dieses Goldbergwerkes zählt die
den Besuchern des gleichnamigen Archäologischen Parks
zugänglich gemachte Galeria dos Alagarmentos, eine
Großraumgalerie, deren Baugeschichte und Funktion bislang
noch weitgehend unbekannt ist, denn herkömmliche
Vermessungsmethoden, die bislang in der Archäologie
angewendet wurden, reichten in diesem komplizierten Stollen und
Schachtsystem nicht aus. Insbesondere eine detaillierte Aufnahme
der vielen einzelnen Abbauspuren und technischen Einrichtungen,
darunter Karrenspurrillen, Nischen für die Beleuchtung und
Balkenauflagen von Maschinen, waren nicht präzise und genau
genug zu dokumentieren. Aus diesem Grunde wurde für die
Vermessung ein terrestrischer Laserscanner eingesetzt. Im Vortrag
sollen dieses Verfahren sowie erste Ergebnisse der aus den Scans
resultierenden 3D-Modellationen vorgestellt werden.
Automatische
3D-Objektrekonstruktion aus unstrukturierten digitalen Bilddaten
für Anwendungen in Architektur, Denkmalpflege und
Archäologie
Thomas P. Kersten, Maren Lindstaedt
Durch das
stetig zunehmende Leistungsvermögen des Internets und der
weiterentwickelten Computer Vision Technologien ist es jetzt
möglich, die 3D-Realität von Objekten unterschiedlicher
Dimensionen mit handelsüblichen digitalen Kameras als
Low-Cost-Systeme für zahlreiche Anwendungen (Renovation,
historische Denkmalpflege, Visualisierung, Analyse des
Bauzustandes und der Beschädigung, etc.) als as-built zu
erfassen. Diverse Webservices (Photofly, ARC3D) und freie
verfügbare Softwarepakete (z.B. Bundler/PMVS2) können
dazu benutzt werden, um 3D-Punktwolken oder vermaschte
Oberflächenmodelle (3D modelliert als Polygone)
einschließlich der foto-realistischen Texturierung von
unterschiedlichen Objekten automatisch zu erzeugen. Diese
sogenannten Low-Cost-Systeme stellen heute für die
3D-Dokumentation von Objekten in der Architektur, Denkmalpflege
und Archäologie eine effiziente Alternative zu den teuren
terrestrischen Laserscanningsystemen dar. Durch den Einsatz
kommerzieller Digitalkameras wird bei der Aufnahme eine
höhere Flexibilität und Aufnahmegeschwindigkeit
gegenüber Scannern erreicht. In diesem Beitrag wird die neue
Aufnahmetechnik z.B. mit einer Nikon D70/D90 bei der
3D-Dokumentation von Kulturgegenständen (historische
Gebäude, Statuen/Figuren, archäologische
Fundstücke, Petroglyphen, etc.) und deren Ergebnisse in
verschiedenen Projekten (Katar, Äthiopien, Norwegen,
Osterinsel, Deutschland, etc.) demonstriert. Nach automatischer
Erstellung der Kamerakalibrierung und der Bildorientierungen eines
unstrukturierten Bildverbandes werden je nach eingesetztem
Webservice oder Softwarepakete aus den Bilddaten dichte 3D-
Punktwolken oder gleich vermaschte Oberflächenmodelle mit
Texturen generiert. Die Genauigkeit der automatisch erzeugten
3D-Modelle wird durch Vergleich mit Ergebnissen vom terrestrischen
Laserscanning aufgezeigt.
Eine Methode zur
3D-Dokumentation eines komplexen Befundes anhand des
frühneolithischen Brunnens von Altscherbitz
Thomas Reuter, Rengert Elburg
Von Anfang
2008 bis Mitte 2010 fand im Landesamt für Archäologie in
Dresden die Ausgrabung eines neolithischen Brunnens statt. Der im
Zuge des Ausbaus des Leipziger Flughafens bei Ausgrabungen in
Altscherbitz gefundene 7100 Jahre alte Anlage wurde als Block
geborgen, von Leipzig nach Dresden transportiert und dort
innerhalb von 28 Monaten ausgegraben. In der etwa 30m³ umfassenden
Verfüllung wurden über 7500 Funde und Proben
dokumentiert. Die genaue tachymetrische Vermessung,
fotografische Dokumentation und das Scannen mit dem hauseigenen
3D-Laserscanner Konica Minolta VI-910 bilden die Grundlage
für die virtuelle Konstruktion des Befundes.
Mit dem Ziel
zunächst nur ein 3D-Modell der Brunnenkonstruktion
aufzubauen, wurde eine Methodik entwickelt, die es erlaubte,
grabungsbegleitend alle Hölzer zeitnah, zerstörungsfrei
und vollständig dreidimensional zu dokumentieren. Im Laufe
des Projektes wuchs der Umfang der räumlichen Informationen,
die in den virtuellen Brunnen integriert wurden, stetig an und der
Anspruch an das dreidimensionale Modell ging schnell über die
reine Visualisierung hinaus. Durch die Integrierung von
Informationen z.B. der Stratigraphie, der dendrologischen
Untersuchungen, Berechnungen zu Volumina von Aushüben und
Verfüllung oder zur Lage aller Funde (als gescanntes Modell
oder zumindest als generalisiertes Objekt), bildet das 3D-Modell
jetzt eine wichtige Grundlage für die wissenschaftliche
Auswertung und letztendlich der Generierung archäologischen
Wissens.
Nicht nur der
virtuelle Befund in seiner Gesamtheit, sondern auch die einzelnen
hochauflösenden 3D-Modelle der etwa 180 Hölzer an sich
haben wichtige Erkenntnisse zur Holzbearbeitung im frühen
Neolithikum geliefert, die dann z.B. in praktischen Experimenten
nachvollzogen wurden bzw. noch werden sollen. Die 3D-Dokumentation
brachte des Weiteren eine beträchtliche Zeitersparnis bei der
Katalogerstellung mit sich. So konnten die Abbildungen, der
dazugehörige Holzkatalog, mit stilisierten Computergrafiken
und dazugehörigen Profilen aus TroveSketch, bereits 5 Monate
nach Ende der Grabung fertig gestellt werden.
Die noch
laufende Aufarbeitung der gesammelten Informationen lassen weitere
Erkenntnisse über Bautechnik, Holzwirtschaft und
gesellschaftliche Organisation in Mitteldeutschland zur Zeit des
frühen Neolithikums erwarten.
Die
Präsentation stellt die entwickelte Methodik zur
grabungsbegleitenden 3D-Dokumentation vor, die zurzeit auch bei
einem mittelalterlichen Brunnen in Mittelsachsen und
montanarchäologischen Untersuchungen im Erzgebirge
erfolgreich Anwendung findet. Es werden Vorteile und Probleme
aufgezeigt und Ergebnisse der laufenden Analysen vorgestellt.
Automatisierte
3D-Objektdokumentation auf der Grundlage eines Bildverbandes
Sebastian Vetter, Gunnar Siedler
Die
stereoskopische Aufnahme von Objekten bietet die Möglichkeit
einer dreidimensionalen Objekterfassung sowie einer
anschließend maßstabsgerechten Projektion der
Objektoberfläche auf eine geeignete Geometrie. Durch die
Integration automatisierter Verfahren der digitalen
Bildverarbeitung im orientierten Stereomodell
(Matchingalgorithmen) werden 3D-Oberflächen dreidimensional
erfasst.
Mit Hilfe eines automatisierten Punktsuchalgorithmus werden im
Bildverband identische Punkte erkannt um Bilder zu Stereomodellen
zu zuordnen. Die in den Bildern gefundenen Punkte werden sowohl
für die Berechnung der relativen Orientierung eines Stereomodells
als auch für die Berechnung der Nachbarschaft der Stereomodelle
verwendet.
Unter Verwendung von geeigneten Filterstrategien kann die relative
Orientierung automatisch berechnet werden, wobei fehlerhafte
Punkte entfernt werden. Mit Hilfe von 3D-Passpunkten oder einer
Strecke am Objekt bzw. der Kamerabasis wird das Stereomodell
absolut orientiert.
Mit einem Expansions- und Matchingalgorithmus wird die
Objektoberfläche im Stereomodell automatisch „gescannt“. Die
erzeugten Teilpunktwolken – je Stereomodell eine – können
dann mit dem integrierten Iterative Closest Point-Algorithmus
(ICP) zueinander transformiert und anschließend zu einer
Gesamtpunktwolke zusammengeführt werden.
Im nächsten Schritt wird die 3D-Punktwolke mit dem
integrierten Triangulationalgorithmus trianguliert. Das dabei
erzeugte digitale Oberflächenmodell (DOM) kann mit den für
das „Scannen“ der Objektoberfläche verwendeten Bildern texturiert
werden.
Das Oberflächenmodell dient außerdem als Grundlage für
Abwicklungen oder Orthoprojektionen der Objektoberfläche auf
eine geeignete Geometrie, im einfachsten Fall auf eine Ebene.
Unter Verwendung von Digitalen SLR Kameras mit Vollformatsensor
kann eine hohe Genauigkeit erzielt werden.
Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, die
Qualität und Genauigkeit der 3D-Objektdokumentation durch die
Auflösung der Bilder zu steuern. Das hier beschriebene
Verfahren wurde im Rahmen eine Entwicklungsprojektes in metigo3D
möglich.
Virtuelle
Architekturrekonstruktionen mit Mehrwert
Joyce Wittur
Es werden
immer mehr computergestützte Rekonstruktionen erstellt und in
Museen, Fernsehbeitragen, im Internet oder auf anderen Medien dem
Publikum präsentiert. Viele dieser Rekonstruktionen erwecken
mit oftmals fotorealistischen Bildern den Eindruck, als ob jeder
Teil des dargestellten Gebäudes mit der gleichen
Wahrscheinlichkeit rekonstruiert werden könnte. Dies ist
natürlich nicht der Fall.
Das
heterogene und bruchstückhafte Ausgangsmaterial
(archäologische Funde und Befunde, Texte, Bilder, Analogien)
bietet viel Raum für Unsicherheiten und alternative
Interpretationen. Um den Betrachter über diesen Umstand zu
informieren, wäre es sinnvoll, diese Informationen in das
Modell zu integrieren und anzuzeigen. Besonders virtuelle
Rekonstruktionen bieten viele Möglichkeiten, da sich bei
ihnen mit verschiedenen Darstellungsmodi, Interaktivität oder
der Integration von Zusatzinformationen arbeiten lässt.
Die Art, wie
die Modelle präsentiert werden sollten, um den Betrachter
über Unzulänglichkeiten des Modells zu informieren,
hängt aber nicht nur vom vorhandenen Ausgangsmaterial
und dessen Interpretation, sondern auch vom angestrebten
Anwendungsgebiet der Rekonstruktion ab.
An Hand von
Beispielen sollen verschiedene Anwendungsgebiete vorgestellt
werden, genauso wie Möglichkeiten um auf Unsicherheiten,
verwendetes Quellenmaterial und alternative Rekonstruktionen
hinzuweisen.
Grundlage
für eine solche „ethische“ Darstellung ist ein systematisches
Vorgehen beim Erstellen der Rekonstruktion. Nur wenn die
Ausgangsdaten, deren Bewertung und Einschätzung, die
Interpretationen und weiterführenden Entscheidungen gut
dokumentiert sind, können Unsicherheiten, Alternativen und
Abhängigkeiten im Modell sicher identifiziert werden.
Dies kann
auch als Mittel zur Qualitätssicherung dienen.
Zusätzlich kann die Dokumentation hilfreich sein, wenn
Änderungen am Modell durchgeführt werden sollen oder um
Strategien zur Datenerhaltung zu entwickeln. Auch hierauf soll im
Vortrag eingegangen werden.
Einsatz von
3D-Computertomographie am Beispiel der frühmittelalterlichen
Spatha
Ulrich Lehmann
Die
3D-Computertomographie kommt in der Archäologie in erster
Linie dann erfolgreich zum Einsatz, wenn kleine bis
mittelgroße Konglomerate aus verschiedenen Bestandteilen
zerstörungsfrei untersucht werden sollen. Die Spanne der
möglichen Objekte für einen solchen Scan reicht von
eingegipsten Blockbergungen bis zu filigranen Schmuckstücken.
Das nach den Messungen erstellte digitale 3D-Modell gibt die
räumliche Beziehung der im Konglomerat enthaltenen Elemente
oder Gegenstände anhand der jeweiligen Dichte der Materialien
an. Bei vielen Stoffen liefert die Untersuchung bereits sehr gute
Ergebnisse, Edelmetalle erzeugen jedoch derzeit eine relativ
starke bildliche Verzerrung.
Die fast
ausschließlich aus Gräbern stammende
frühmittelalterliche Spatha weist eine aus verschiedenen
Bestandteilen hergestellte Klinge und zumeist Reste von
organischen Materialien der Schwertscheide und des Griffes auf.
Durch herkömmliche Untersuchungsmethoden (Röntgen,
Mikro- und Makroskopie) sind Abfolge und Aufbau der Schichten im
Grunde nicht – vor allem nicht zerstörungsfrei – zu
rekonstruieren. Diese Funde bieten sich daher in besonderem
Maße für eine 3D-Computertomographie an.
Anhand von
Röntgenbildern wird ein günstiger Bereich des Fundes
für die Messung ausgewählt. Je kleiner dieser ist, desto
höher ist die Auflösung des später errechneten 3D-
Modells. Bei einem würfelförmigen Untersuchungsfeld von
etwa 6 cm Kantenlänge – das entspricht zumeist der maximalen
Klingenbreite – beträgt die Kantenlänge der Voxel, aus
denen das digitale Modell aufgebaut wird, nicht mehr als 0,05 mm.
Das 3D-Modell
dient als Grundlage für die anschließende Bearbeitung.
Es kann in jeder beliebigen Achse geschnitten werden. Für die
Interpretation der frühmittelalterlichen Spatha hat sich die
Erstellung von Graustufenschichtbildern des Quer-, Längs- und
Frontschnitts in möglichst geringem Abstand als günstig
erwiesen. Zu Slideshows oder Filmen arrangiert geben die
Bildstapel einen Eindruck der Verteilung der unterschiedlichen
Materialien, aus dem sich Aufbau und eventuell auch
Herstellungsweisen von Klinge, Griff und Schwertscheide ableiten
lassen.
Diskussionspunkte
stellen weitere Verwendungsmöglichkeiten der 3D-Modelle, etwa
durch Einfärben der verschiedenen Dichten, sowie die
Präsentation der Ergebnisse in Printmedien und die
Bereitstellung der großen Datenmengen dar.
Standardisierte
Vokabulare in archäologischen Datenbanken
Hendrik Jostes, Mathias Lang
Semantische
Referenzmodelle wie das CIDOC-CRM werden seit Jahren als
Allheilmittel für die Verbindung und Beschreibung heterogener
Datenstrukturen in der Archäologie angepriesen. Diese
gewährleisten zwar eine Interoperabilität der Klassen
und Relationen zwischen unterschiedlichen Systemen, tragen aber
kaum zu einer inhaltlichen Erschließung der
Datenbestände bei. So können sich zwar unterschiedliche
Datenbanken darüber austauschen, wo Typologien und
Klassifikationen im jeweiligen System vorgehalten werden, wie
diese sich jedoch inhaltlich zueinander verhalten, kann jedoch
kaum in der notwendigen Tiefe abgebildet werden.
Eine
Interoperabilität auf dieser inhaltlichen Ebene kann nur
durch ein kontrolliertes Vokabular erreicht werden, welches in das
semantische Gerüst der Ontologie eingebunden ist. Ein
herkömmlicher Thesaurus ist jedoch kaum in der Lage diese
Anforderung zu erfüllen, ist er in seiner Gestaltung doch
stets monohierarchisch und einsprachig. Wir haben uns daher
entschieden, einen SKOS-XML-Thesaurus zu implementieren, der
für diese Aufgabe weit besser geeignet erscheint.
Das vom W3C
spezifizierte SKOS (Simple Knowledge Organization System; http://www.w3.org/2004/02/skos/)
ermöglicht die einfache Veröffentlichung und Kombination
kontrollierter, strukturierter und maschinenlesbarer Vokabulare
für das Semantic Web sowie die eindeutige Identifizierung der
einzelnen Begriffe im Internet durch URIs (Universal Resource
Identifiers) in standardisierter Form. Bestehende Vokabulare
können leicht um weitere Sprachen und Synonyme erweitert
werden, ohne strukturelle Änderungen an der Struktur des
Thesaurus vorzunehmen. Dies ist möglich, da sich Relationen
stets auf das Konzept eines Begriffes und nicht auf den Begriff
selbst beziehen. Somit kann jedem Konzept eine beliebige Anzahl
alternativer Begriffe zugeordnet werden, welche automatisch die
Relationen des Konzeptes erben.
Durch diese
Funktionalität kann der Thesaurus leicht an die
Bedürfnisse der einzelnen Systeme angepasst werden. Wird
beispielsweise in den verschiedenen Datenbanken ein Begriff, ein
Name oder ein Toponym in unterschiedlicher Schreibweise oder
Sprache (Artemis-Tempel – Artemistempel; Köln – Cologne –
Colonia – Kölle) verwendet, so können sämtliche
Schreibweisen zu einem Konzept zusammengefasst und gemeinsam
verarbeitet werden.
Für die
Verwendung von SKOS sprach auch die Möglichkeit,
polyhierarchische Vokabulare anzulegen. Für jedes Konzept
können beliebig viele Überordnungen vorgesehen werden.
So ist es problemlos möglich, das Konzept „Messer“ sowohl
unter „Waffe“ als auch unter „Küchengerät“ abzulegen.
Im Rahmen
unseres Vortrags werden wir die Grundlagen und die
Möglichkeiten, aber auch die Probleme eines SKOS-Thesaurus an
einer exemplarischen Implementierung eines umfangreichen
Vokabulars zur Archäologie des Mittelmeerraumes diskutieren.
Des Weiteren werden wir ein von uns im Rahmen eines studentischen
Projektes entwickeltes Werkzeug besprechen, das die Erstellung und
Verwaltung der Vokabulare gegenüber den bisherigen
Möglichkeiten stark vereinfacht.
Abschließend
wollen wir einen Diskurs über die Möglichkeiten der
Verwaltung gemeinsamer SKOS-Vokabulare, bzw. den Austausch von
solchen Thesauri anstoßen. Aufgrund seiner standardisierten
und maschinenlesbaren Form bietet sich SKOS für ein solches
Vorgehen im besonderen Maß an.
Zusammenführung
und Darstellung raumbezogener archäologischer Daten aus dem
Forschungsprojekt „Laubacher Wald“ in einer virtuellen Umgebung
Peter Marchel, Heiko Peter, Radouane Ait-Jellal , Yan
Dong, Almat Reusch, Haoyu Wang,
Jens Orthmann, Martin Lambers,
Michael Gottwald, Christoph Röder, Udo Recker
Die digitale
Dokumentation und Darstellung archäologischer Funde und
Befunde gilt heutzutage als Standard bei jeder wissenschaftlichen
Arbeit. Dazu zählen unter anderem Höhenmodelle des
Geländes, 3D-Modelle von Funden, entzerrte und
georeferenzierte Fotos und Pläne, Luftbilder sowie
geophysikalische Messungen und verschiedene thematische Karten.
In diesem
Vortrag beschreiben wir ein System um solche verschiedenartigen
Daten in einer gemeinsamen virtuellen Umgebung
zusammenzuführen und in ihrem räumlichen Bezug
zueinander in einem Virtual Reality (VR) Labor zu explorieren.
Dabei steht nicht nur die Navigation im Vordergrund, sondern auch
die Interaktion, z.B. durch das Platzieren von Objekten oder das
Wechseln von Karten. Diese Eigenschaft unterscheidet das System
von existierenden Ansätzen. Neben der Entwicklung
interaktiver Bedienkonzepte zählen auch die Datenfusion und
die Verwaltung großer Datenmengen zu den
informationstechnischen Herausforderungen.
Das System
wird in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Hessen im Rahmen einer studentischen Projektgruppe an der
Universität Siegen entwickelt. Als Anwendungsbeispiel dient
die ca. 20 km² umfassende Fläche der LiDAR Befliegung
des „Laubacher Waldes“ in der Gemeinde Laubach, Kreis
Gießen. Die bereits durch zahlreiche Grabungen und
Prospektionen in den letzten Jahren erforschte Region ist reich an
gut erhaltenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Bodendenkmälern.
Der
Basisdatensatz, die 3D-Abbildung der Landschaft, besteht aus einem
Höhenmodell welches mit LiDAR-Messungen aufgenommen wurde.
Luftbilder und thematische Karten werden als Textur auf diese
Landschaft gelegt und können beliebig kombiniert werden. So
kann ein Untersuchungsgebiet in verschiedenen Ansichten
(Luftbilder, topographische Karte, Bodenkarte, usw.) dargestellt
werden ohne den Blickwinkel zu ändern. Gerade durch die
Kombination von verschiedenen Daten in einer Darstellung ergibt
sich ein Mehrwert für die wissenschaftliche Betrachtung: Das
Nebeneinander von Informationen weicht der Möglichkeit, Daten
zu vergleichen, daraus gewonnene Ergebnisse zu verschneiden und
neue Schlüsse zu ziehen. Das VR-System übernimmt dabei
das Matching von Daten und Höhenfeld mit Hilfe der
Georeferenzdaten. Damit wird sichergestellt, dass die
Karteninhalte unabhängig ihres Maßstabes der richtigen
Position auf der Fläche zugeordnet werden.
Aufgrund der
großen Datenmenge werden Kartensegmente – in
Abhängigkeit der Position des Betrachters – detailvariabel
dargestellt. Dies geschieht, um nicht an Hardwaregrenzen zu
stoßen, wie etwa einem zu kleinen Arbeitsspeicher oder einer
zu langsamen Grafikkarte. Weiter entfernte Kartensegmente werden
mit einer niedrigeren, nahe in einer höheren Detailstufe
gezeichnet.
Für die
effiziente Arbeit mit Daten sind diverse genormte Markierungen von
Nöten, um besondere Gebiete wie z.B. Wege, Gewässer,
Bergbauspuren, natürliche und anthropogen angelegte
Böschungen, Ackerterrassen und weitere Plätze, die von
archäologischer Bedeutung sind, hervorzuheben. Die Software
erlaubt es diese Marker interaktiv auf der Karte zu platzieren und
bearbeitete Karten zusammen mit den platzierten Markern zu
speichern. Des Weiteren besteht die Möglichkeit nach Markern
zu filtern. Die Anzeige kann so auf bestimmte Symbole begrenzt
werden.
Derzeit
erlaubt das interaktive System die Navigation über mehrere
Karten, das Markieren von Fundstellen sowie das Speichern und das
Laden der erarbeiteten Szene. Im weiteren Verlauf des Projekts ist
geplant, die Marker um Kontextinformationen, wie textuelle
Fundortbeschreibungen oder das Einzeichnen und Vermessen von
Wegstrecken bzw. Flächen, zu erweitern. Eine individuell
einstellbare Lichtquelle soll es ermöglichen, kleinste
Erhebungen sichtbar zu machen.
Analysen im
dreidimensionalen Bereich: Burgen, Siedlungen und Landschaften in
neuem Licht
Jörg Nowotny
Stetig
leistungsfähigere Hardwareressourcen und die Entwicklung
immer komplexerer Softwarelösungen für den Bereich der
Geoinformation eröffnen der Archäologie völlig neue
Dimensionen. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden
Rohdaten ermöglichen dabei immer detailliertere virtuelle
Auswertungen archäologischer Projekte. Lag der Fokus zu
Beginn der Nutzung von CAD- oder GIS- Software
ausschließlich auf der zweidimensionalen Analyse, so
können nunmehr ganze Grabungen auch im dreidimensionalen Raum
projiziert werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die
Datengrundlage in Form von Altgrabungen oder aktuellen Projekten
vorliegt. Exemplarisch sollen für den Workshop als Altgrabung
die in den 1930er Jahren durchgeführten Arbeiten an der
sächsischen Burganlage „Stellerburg“ in Dithmarschen
vorgestellt werden. Hier war es möglich, knapp 16000 Objekte
aus 750 Einzelplänen herauszuarbeiten und sie sowohl zwei-
als auch dreidimensional zu projizieren. Die Auswertung im
dreidimensionalen Bereich ermöglichte die Herausarbeitung
weiterer möglicher Befunde auch in den Grabungsbereichen, in
denen keine oder nur sehr wenige Informationen aus den Plana zu
entnehmen waren. Zum ersten Mal konnte neben der 1943 publizierten
nördlichen Toranlage auch das Osttor der Burg erfasst und
rekonstruiert werden. Ebenso einmalig sind die Ergebnisse, die die
dreidimensionale Erfassung und Visualisierung der beiden durch das
Burginnere führenden Bohlenwege erbracht haben. Die
Ergebnisse der GIS- Aufarbeitung zeigen deutlich das Potential,
das an Erkenntnisgewinn im Vergleich mit älteren Auswertungen
steckt. Sie wurden im Rahmen einer Promotion von Thorsten Lemm,
M.A. angefertigt.
Für die
Nutzung von 3D in einem weitaus kleinräumigeren Projekt steht
die Aufarbeitung der jüngsten Siedlungsgrabung in Haithabu,
welche von 2005–2009 stattgefunden hat. Auch hier
ermöglicht die Kombination der zweiten mit der dritten
Dimension völlig neue Perspektiven der Bearbeitung. So lassen
sich nicht nur die Plana Schicht für Schicht visualisieren,
sondern auch die Konstruktionsweisen der angetroffenen
Grubenhausbefunde. Es konnte die Siedlungsstruktur und die
Siedlungsdynamik eines vermutlich überwiegend handwerklich
genutzten Areals der Siedlung erfasst werden: die sich um einen
freien Platz gruppierenden Grubenhäuser, die beiden Brunnen
zur Wasserversorgung, die Grubenkomplexe und nicht zuletzt die
regelhafte Anlage des Wegenetzes.
Einen kleinen
Einblick sozusagen unter die Wasseroberfläche gibt die
3D-Visualisierung von Fundstellen der Ertebølle-Kultur im
Bereich des Kieler Hafens, die im Zuge der ab den 1880er Jahren
durchgeführten umfangreichen Baumaßnahmen von Werft und
Marineanlagen auf dem Ostufer der Kieler Förde zutage kamen.
Dafür konnten Unterlagen von 1883 herangezogen werden, die
den damaligen Küstenverlauf und die Landschaft unter der
Wasseroberfläche aufzeigten. Ein Vergleich mit aktuellen
Daten zeigt die ungeheuren Veränderungen der vergangenen 130
Jahre im Bereich des Kieler Hafens und hilft bei der Suche nach
weiteren Hinweisen zu dieser Kultur. War auf der Kartierung von
1883 noch eine wahrscheinlich weichselzeitliche Moräne der
letzten großen Vergletscherung vorhanden, so ist diese heute
fast vollständig verschwunden. Eine vermutliche Auskolkung
nach Durchbruch von Schmelzwasser durch diese Moräne,1883
noch 32 Meter tief, ist bis auf 20 Meter aufgefüllt.
Dynamische Veränderungen zeigt auch der Küstenverlauf,
der auch auf dem Westufer heute ein deutlich anderes Gesicht zeigt
als noch vor 130 Jahren.
Kammergräber als 3D-Puzzle
Karin Göbel
In den
letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, die
Grabungsdokumentationen der Kammergräbern aus
Neudorf-Bornstein aus Schleswig-Holstein (3. Jh. n. Chr.), aus
Poprad- Matejovce in der Slowakei (Ende 4.Jh. n. Chr.) oder die
Gräber aus Pilgramsdorf/Pielgrzymka (3. Jh. n. Chr.) aus
Polen in ein GIS zu überführen. Anhand dieser Beispiele
lassen sich eindrucksvoll die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen von ArcGIS aufzeigen.
Dabei spielt
die 3D-Visualisierung immer eine entscheidende Rolle. Auf diese
Weise können die dokumentierten Funde und Befunde wieder an
ihrer ursprünglichen Position gezeigt werden. Fehlende
Höheninformationen lassen sich häufig durch
Profilzeichnungen oder anhand von Fotos, auf denen die Position
der Teile zueinander sichtbar ist, ermitteln. Die Arbeit erfolgt
im Gegensatz zu einer Ausgrabung systematisch von unten nach oben.
Erst nach dem Zusammenfügen sämtlicher dokumentierter
„Puzzlesteine“, sollte mit der Rekonstruktion fehlender Teile
begonnen werden. Bereits vorhandene „Rekonstruktionen“ von den
Gräbern sind in dieser Phase eher störend, da diese die
objektive Wahrnehmung beeinflussen können. Sie sollten erst
zum Abschluss Berücksichtigung finden.
Durch die
Überführung in ein geografisches Koordinatensystem wird
der Blick in die Umgebung der Gräber gelenkt. Nicht nur die
Position der Gräber zueinander, sondern ihre Lage in der
damaligen Landschaft mit den dazugehörigen Siedlungen, Wegen
und Kultplätzen gewinnt an Bedeutung. Für die
Landschaftsanalysen stehen mittlerweile zahlreiche Werkzeuge, wie
z. B. Sichtbarkeits- und Wegstreckenanalysen zur Verfügung.
Moderne Höhenkarten sollten dafür nur in Kombination mit
altem Kartenmaterial unter Berücksichtigung der
möglichen geomorphologischen Prozesse und menschlichen
Aktivitäten genutzt werden. Pollendiagramme geben Hinweise
auf den möglichen Bewuchs. Erst durch das Zusammenfügen
sämtlicher vorhandener Puzzlesteine lässt sich
sicherlich auch dann noch sehr schemenhafte Vorstellung über
die Menschen gewinnen, die vor so langer Zeit in diesen
Gräbern bestattet wurden.
Ice Patches im Silvrettagebirge (CH/A) -
Methodische Überlegungen zur alpinen
Gletscherarchäologie. Eine exemplarischen Studie
Leandra Naef
Obwohl seit
dem Sensationsfund „Ötzi“ bereits 20 Jahre vergangen sind und
das rapide Abschmelzen der alpinen Gletscher bestens bekannt ist,
wurden in Europa bislang kaum methodische Grundlagen für eine
systematische alpine Gletscherarchäologie entwickelt.
Im Rahmen
eines Forschungsseminars zur „Landschaftsarchäologie“ (Prof.
K. Lambers & Prof. Ph. Della Casa) setzte sich im
Frühjahr 2011 eine Projektgruppe der Abteilung Ur- und
Frühgeschichte der Universität Zürich eine
Kartierung von alpinen Ice Patches mit erhöhtem
archäologischem Fundpotenzial zum Ziel. Diese wertvollen
Fundarchive sollen für die Beantwortung von Fragen zur
prähistorischen und historischen Landschaftsnutzung – im Speziellen zu
Kommunikationskorridoren und zur Ausbeutung von Jagdressourcen – in einer
hochalpinen Region erschlossen werden, bevor sie der
Zerstörung bzw. dem Abschmelzen zum Opfer fallen. Das
untersuchte Testgebiet ist Teil der Silvrettagruppe im
Schweizerisch-Österreichischen Grenzgebiet und umfasst den
Übergangsbereich zwischen den drei Tälern Val
Urschai/Val Tasna, Val Fenga/Fimbatal und dem Jamtal.
Um das
Fundpotenzial von Ice Patches in diesem Gebiet evaluieren zu
können, wurde ein auf Literaturrecherchen und Expertenwissen
basierender Kriterienkatalog erstellt. Erfasst wurden Faktoren,
welche die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von Funden
und deren Erhaltung in Ice Patches positiv beeinflussen. Die
Visualisierung dieser Faktoren bzw. Kriterien fand mit dem
Programm ArcGIS statt. Luftbilder, Geländemodelle,
historische Gletscherstände, topographische Karten sowie
moderne und historische Wegkarten bildeten die Grundlage für
die Kartierung. Das Resultat ist ein priorisiertes
Vorhersagemodell (‚predictive model’), nach dem im Spätsommer
2011 ausgewählte Ice Patches systematisch prospektiert
wurden.
Diese
exemplarische Untersuchung soll im Rahmen meiner MA-Arbeit – u.a. mit Hilfe
eines automatisierten GIS-Modells – weiterentwickelt und auf ein
grösseres Untersuchungsgebiet (Kanton Graubünden, CH)
angewendet werden. Ziel ist es, auf diesem Weg für die
Zukunft ein gezieltes Monitoring vielversprechender
Eisflächen zu gewährleisten sowie eine methodische
Grundlage für eine systematische alpine
Gletscherarchäologie zu schaffen.
(Online-Artikel
im Rahmen des Forschungsseminars „Landschaftsarchäologie“;
vor den Feldbegehungen publiziert, 22.06.11: http://www.prehist.uzh.ch/onlineart/SilvrettaIcePatches1.htm)
Signale einer ökologischen
Krise? Eine vergleichende geoarchäologische Umfeldanalyse
anhand der Daten der frühen Eisenzeit bis zum
Frühmittelalter im Odergebiet
Armin Volkmann
Im Rahmen der
Studie wurde eine flächendeckende und vor allem systematische
Umfeldanalyse (Site Catchment Analysis) der Fundstellen der
frühen Eisenzeit bis zum slawischen Frühmittelalter in
der Oderregion angewandt. Dazu wurde ein neues methodisches
Konzept entwickelt, wobei innerhalb eines normierten
Schlüssels der Geoinformationen die Daten zur folgenden
kartographischen und statistischen Analyse erhoben wurden. Als
Datenbasis konnten durch entsprechende Kooperationspartner der
Fachbehörden hoch detaillierte, nicht frei verfügbare
Datensätze und digitale Kartenbestände standardisiert
ausgewertet werden. Daneben wurden aber auch als
geoarchäologische Synthese die archäologischen
Fundstellenmeldungen in den Archiven und in der relevanten
Fachliteratur als Datenbank und Katalog grenzüberschreitend
zusammengeführt. Im Rahmen dessen erfolgte eine intensive
Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Fundmaterial. So entstand
ein ganz neues, erstaunlich dichtes Fundstellenbild. Für alle
Fundstellen wurde die Fundstellenart und -datierung intensiv
geprüft, da eine möglichst feinchronologische Datenbasis
eine unabdingbare Grundlage für die folgende Umfeldanalyse
war.
So wurde ein
überarbeitetes Chronologiesystem für die frühe
Eisenzeit bis zum slawischen Frühmittelalter für die
Oderregion entwickelt. Neben der sehr wichtigen Feindatierung der
Fundstellen wurden auch deren Fundlage und -umstände kritisch
beleuchtet und exakt korrigiert, da diese selektiven Faktoren
stark auf das Fundstellenbild des Abschnitts der
siedlungsarchäologischen Studie wirken. Im Rahmen dieser
Quellenkritik wurde des Weiteren auf die Forschungsgeschichte
eingegangen, die den Forschungsstand grundlegend prägte.
Innerhalb dieser wurden insbesondere auf der Mikroebene neueste
Untersuchungen zum Siedlungsaufbau und zu Hauskonstruktionen der
Völkerwanderungszeit im Odergebiet vorgestellt.
Die
GIS-Analyse ist in vier verschiedene methodische Ansätze
unterteilt worden. Als erste GIS-Untersuchung erfolgte eine
Umfeldanalyse, der topographischen Lage, des Bodens und weiterer
geoökologischer Parameter bei der die Geodateninformationen
in einem wahrscheinlichen Aktionsradius um die jeweiligen
Siedlungen der einzelnen Stufen aufgenommen und statistisch
ausgewertet wurden. So konnten statistisch signifikante
„Klimaproxys“ zum relativen Feuchteindex und Temperaturverlauf des
Paläoklimas herausgestellt werden. Des Weiteren wurden die
dezidierenden Standortfaktoren des Bodens und des
geoökologischen Siedlungsumfelds sowie verzerrend wirkende
anthropogene und natürliche Überprägungen
diskutiert. Die ökologischen Zeigerwerte wurden in
Transformationsverfahren hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit und
Aussagekraft für Belange von prähistorischen, agrarisch
orientierten Kulturen, in prägnanten Klassen neu
zusammengestellt und auf Klimasignale überprüft. Zur
Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit und klaren
Belegbarkeit der Ergebnisse wurde auf komplexere, analytisch
beschreibende, stochastische Verfahren verzichtet. Die
identifizierten Klimasignale stellen dabei keine absoluten Daten
dar, sondern es handelt sich um indirekte, relative Daten, die
jeweils vergleichende Aussagen zur vorhergehenden und folgenden
Zeitstufe zulassen.
Innerhalb der
GIS-Untersuchung wurde anschließend die Fundstellenlage,
jeweils nach den einzelnen Fundstellenarten, in den jeweiligen
Zeitstufen im geographischen Raum kartographisch erforscht. Der
dritte GIS-Teil analysierte, basierend auf Voronoi-Diagrammen der
Fundstellenkartierungen als prähistorische Raummodelle, die
Raumkonzepte im zeitlichen Verlauf. Darüber hinaus wurden
viertens der Nutzen und das Potential von fernerkundlichen
Methoden sowie historischen Kartenwerken untersucht.
Zum Schluss
konnte anhand von vergleichenden Klimaforschungen, der
Palynologie, Dendrochronologie, der Gletscherstände und
Eisbohrkern Isotop-Analysen, der paläohydrologischen
Flußpegel und der mathematischen Modelle zur Errechnung der
Paläotemperatur, die im Rahmen der GIS-Umfeldanalyse
herausgestellten Klimasignale überprüft und diskutiert
werden. So wurde die Wahrscheinlichkeit und Prägnanz der hier
erarbeiteten Umfeldanalyse und deren besonderer
feinchronologischer Wert signifikant belegt.
Zyklen neolithischer Wirtschaft: Eine
neue und robuste 14C-Chronologie europäischer Silexminen
Tim Kerig, K. Edinborough, S. Downey, S. Shennan
Zu den beeindruckendsten neolithischen Kulturerscheinungen
gehören zweifellos Bergwerke. Wir werden ein Modell der
Abbautätigkeit der europäischen Silexbergwerke (aus
England und Schottland, Frankreich, den Beneluxstaaten,
Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Schweden und
Dänemark, Polen, Weissrussland und Litauen) vorstellen.
Grundlage dieses Modells sind kalibrierte 14C-Daten. Eine neue
Methode erlaubt die Zusammenfassung dieser Daten in einer Kurve
mit zugehörigem Konfidenzintervall. Dieses Konfidenzintervall
berücksichtigt sowohl Maschinen-/Laborfehler als auch die
durch die Kalibrationskurve gegebenen Unsicherheiten. In die
Berechnungen gingen insgesamt 518 Radiocarbondaten von 57
Fundorten ein. Der Rechenweg wird kurz vorgestellt, wobei u.a.
Markov-Ketten-Monte-Carlo (MCMC) Verfahren und LOESS Modelling zum
Einsatz kommen. Das Ergebnis ist dann eine Schätzung für
den Mittelwert und ein 95% Konfidenzintervall.
Wir argumentieren, dass diese Daten als Schätzwerte für
die Intensität der Abbautätigkeit im Laufe der Zeit
verwendet werden können und dass dabei wesentliche Trends der
europäischen Wirtschaftsentwicklung im Zeitbereich 6000 calBC
bis 2000 calBC erkennbar werden. Diese Trends entsprechen zeitlich
den kulturhistorischen Perioden des zentraleuropäischen
Neolithikums (Alt-, Mittel-, Jung-, Spät- und
Endneolithikum); auch können diese Trends zu Anzeigern
(Proxies) für Bevölkerungszahlen in Relation gesetzt
werden.
Wir interpretieren die Schwankungen der Aktivitäten im
Bergbau als Schwankungen in der Intensität neolithischer
Austauschbeziehungen.
Die Arbeiten wurden ermöglicht durch den ERC Advanced
Research Grant #28973498237.
CA-Trend-Projektion: Eine neue Methode
für die Relativchronologie
Georg Roth
Der Vortrag
behandelt die verbesserte relativchronologische Auswertung einer
Korrespondenzanalyse (CA) durch die Ermittlung ihres Trends und
seiner Verwendung zur Ähnlichkeitsanordnung.
Die CA ist ein Standardverfahren zur Ermittlung von
Relativchronologien. Die interessierenden Befunde erscheinen dabei
in den Zeilen, die Typen in den Spalten einer Tabelle. Bei der
CA-Anwendung erhofft der Archäologe eine annähernd
parabelförmige Wolke der Zeilenpunkte in der
Ordinationsgrafik, weil dies auf einen gleichförmig wirksamen
Kausalgradienten – die Zeit – hinweist. Der Zeilenpunkt-Abstand in
der Grafik (dem sog. Biplot) entspricht weitestgehend der
Unähnlichkeit der Zeilenpunkte (M. Greenacre,
Correspondence Analysis in Practice (London 2007), 71; D.
Borcard/Fr. Gillet/P. Legendre, Numerical Ecology with R (New York
u.a. 2011), 132f). Der Trend der (Un-) Ähnlichkeit
verläuft nun im Biplot entlang einer gedachten Mittelachse
der Parabelwolke. Bisher wurden die Zeilenpunkt-Koordinaten auf
der ersten CA-Achse als Repräsentation der chronologischen
Abfolge verwendet. Eine Projektion der Zeilenpunkte auf die
gedachte Mittelachse erlaubt eine vollständigere Nutzung des
CA-Ergebnisses.
Das Verfahren beruht auf der Verwendung der statistischen
Programmieroberfläche R (R Development Core Team, R: A
language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing (Vienna 2011); http://www.R-project.org).
Zunächst wird mit dem Paket „ca“ (M. Greenacre/O. Nenadic,
ca: Simple, Multiple and Joint Correspondence Analysis. R package
version 0.33 (2010). [CRAN.R-project.org/package=ca]) eine
Korrespondenzanalyse berechnet. Nun berechnet man mit einem
Loess-Schätzer (W. Cleveland/S. Devlin, Locally Weighted
Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting.
Journal of the American Statistical Association 83 (Nr. 403),
1988, 596–610) die Parabelwolken-Mittelachse. Dann werden die
Zeilenpunkte dem nächsten Trendlinienpunkt zugeordnet.
Abschließend projiziert man Trendlinie und Zeilenpunkte in
eine Dimension. Diese Zeilenpunktabfolge verwendet jetzt die
ersten beiden Dimensionen (Biplot-Achsen) zur
Ähnlichkeitsanordnung. Das Verfahren wird anhand der von
Höhn (B. Höhn, Die Michelsberger Kultur in der Wetterau.
UPA 87 (Bonn 2002)) zusammengestellten
Typenvergesellschaftungstabelle für Gefäßformen
der Michelsberger Kultur demonstriert.
Poster:
Multidimensionale
Skalierungen metrischer Merkmale älterpaläolithischer
Abschlaginventare
Thomas Weber
Altsteinzeitliche
Abschläge eignen sich auf Grund ihrer Auffindung in oft
großer Zahl sowie des Vorhandenseins einer begrenzten Anzahl
an wohldefinierten Merkmalen für den Einsatz statistischer
Auswertungsmethoden. Die Abmessungen der Stücke sowie die aus
diesen abgeleiteten Formquotienten für die Gestrecktheit
(Klingentendenz) sowie Flachheit (Levallois-Tendenz s. l.), der
Schlagwinkel als Indiz für die benutzte Schlagtechnik und die
Merkmale der dorsalen Bearbeitung als Kriterien der
Materialausnutzung sind seit Jahrzehnten Gegenstand univariater
Untersuchungen. Bei diesen Studien entstehen dann logischerweise
so viele Bilder der Merkmalswerte von altsteinzeitlichen
Fundkomplexen mit ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden, wie
es untersuchte Merkmale gibt.
Multivariate
Verfahren versuchen, diese Informationen aus den einzelnen
Variablen zu bündeln. Außer der Diskriminanzanalyse,
die ein komplexes Abstandsmaß zwischen den Angehörigen
vorgegebener Kollektive – z. B. Abschlaginventaren – zu optimieren
(d. h. die Distanzen zwischen den Gruppen zu maximieren, innerhalb
derselben zu minimieren) versucht, durch eine geschickte
Kombination von Faktoren für die einzelnen Messwerte, kann
hierfür auch die multidimensionale Skalierung (MDS) verwendet
werden. Auch hier werden komplexe Abstände zwischen den
einzelnen – durch eine Anzahl von Messwerten gekennzeichneten –
Inventaren berechnet, aber ohne eine solche Zielvorstellung der
Optimierung von Distanzen a priori klassifizierter Objekte. Es
werden lediglich mehrdimensionale Abstände – mit einer Anzahl
von Dimensionen entsprechend der Anzahl einbezogener Merkmale –
bei einer möglichst geringen Verzerrung („Stress“) auf eine
geringere Anzahl von Dimensionen (möglichst zwei zum Zwecke
der graphischen Darstellung) projiziert. Anhand eines umfassenden
Datensatzes steinzeitlicher Abschlaginventare werden hier die
durch mehrere MDS-Algorithmen erzeugten Bilder verglichen und
Hinweise zu ihrer Deutung gegeben.
Die virtuelle 3D Rekonstruktion des Ostgiebels des
Zeustempels von Olympia
András Patay-Horváth
Der Poster
präsentiert die Resultate eines eben abgeschlossenen,
dreijährigen Projekts, das zur Klärung einer mehr als
hundertjährigen Debatte in der klassischen Archäologie
gestartet wurde. Das Problem besteht in der Anordnung der
einzelnen Mittelfiguren in einem Giebel, eine Lösung wurde
bisher nur in zeichnerischer Form oder mit (verkleinerten bzw.
lebensgrossen) Gipsmodellen versucht. Im aktuellen Projekt wurden
dagegen die neuesten 3D-Technologien eingesetzt, um die alten und
neuen Hypothesen zu testen. Die Fragmente wurden gescannt, die
fehlenden Teile virtuell ergänzt und die daraus
resultierenden 3D-Modelle wurden dann in den ebenfalls virtuell
rekonstruierten ursprünglichen architektonischen Rahmen
eingesetzt. Dieses 3D-Modell ermöglichte ein Experimentieren,
das mit herkömmlichen Mitteln unmöglich oder zumindest
äusserst aufwendig gewesen wäre.
Als Ergebnis
der Experimente konnte festgestellt werden, dass zwei von den vier
theoretisch vorstellbaren (und bisher aus verschiedenen
Gründen befürworteten) Rekonstruktionen aus
räumlichen und ikonographischen Gründen mit
grösster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden
können. Die heutzutage allgemein akzeptierte Rekonstruktion
stellte sich als die unwahrscheinlichste Lösung heraus.
Zum Projekt
ist auch eine zweisprachige CD-ROM erschienen, die die
Problematik, die Forschungsgeschichte, das Projekt und die
3D-Modelle in überschaubarer Form präsentiert und als
Ergänzung zum Poster eingesehen werden kann.
3D-Vermessung als ein hands-on Erlebnis in Tegea
Eva Mortensen, Niels Bargfeldt
Dieses Poster
präsentiert eine Methode komplexe archäologische Befunde
durch 3D Vermessung zu erfassen. Das hellenistische Theater in
Tegea (Griechenland), das im Sommer 2011 neu gezeichnet wurde,
wird hier als Fallbeispiel verwendet, um die Möglichkeiten
dieser Methode zu verdeutlichen. Die Methode erfordert zwei
Personen und eine Totalstation. Eine Person misst mittels der
infraroten Einstellungen der Totalstation Festpunkte, die von der
anderen Person mit einem Reflektor ausgewählt werden.
Verglichen mit dem Stand der modernsten 3D Scanner,
ein-Mann-bedienten Robot-Systemen und GPS, mag die Methode
vielleicht als ein Rückschritt erscheinen. Einige Aspekte
machen die Methode jedoch sehr attraktiv. Vor allem wird das
hands-on Erlebnis bewahrt. Wie bei früheren traditionellen
Handzeichnungen ergibt sich die Möglichkeit ergänzende
Beobachtungen zu machen, da sehr dicht am Fundmaterial gearbeitet
wird. So können zum Beispiel Meißelspuren,
Stoßspuren und abgearbeitete Hebebossen entdeckt werden.
Gleichzeitig ist die Methode präzise, relativ
preisgünstig und der Detaillierungsgrad kann an die
verfügbare Zeit angepasst werden. Die Flexibilität der
Methode gibt den Forschern die Gelegenheit ihre Arbeit an jede
Situation anzupassen, ob es sich um Fundreste auf dem Land, in
flachem Wasser, in einer Höhle oder unter anderen Strukturen
handelt. Leichte Weiterbearbeitung in 3D Software ergibt
eindrucksvolle Drahtgittermodelle, die sehr leicht zu publizieren
oder in Rekonstruktionsmodellierungen einzuarbeiten sind.
Das Potential
archäologisches Material in dieser Weise zu zeichnen, ist
immens und es erlaubt dem Bearbeiter jede Phase des Prozesses zu
kontrollieren. Mit diesem Poster möchten wir gerne einige
Ergebnisse präsentieren.
ArchaeoLandscapes Europe – Ein Netzwerk für
Archäologie und Denkmalpflege
Axel Posluschny
In den
vergangenen mehr als 60 Jahren hat die Luftbildarchäologie
mehr neue Fundstellen zu Tage gebracht, als jede andere
Prospektionsmethode. Seit einigen Jahren gehören aber auch
Satellitenbildauswertung, Airborne Laser Scanning (LiDAR) und
verschiedene andere Prospektionsmethoden zum Methodenkanon der
Archäologie. Gemeinhin werden diese Verfahren unter dem
Oberbegriff „Remote Sensing“ oder auch Fernerkundung zusammen
gefasst, da sie Befunde unter der Boden- oder
Wasseroberfläche berührungs- und zerstörungsfrei
erfassen und dokumentieren können.
Um europaweit
die Kooperation archäologischer Institutionen im Bereich
moderner Prospektionsverfahren zu unterstützen und bestehende
Unterschiede in der Intensität ihrer Nutzung auszugleichen,
hat die EU im Rahmen des Förderprogramms Culture 2007–2013
die Förderung des Projektes ArchaeoLandscapes Europe (kurz ArcLand; http://www.archaeolandscapes.eu)
beschlossen. Es ist das Ziel dieses Projektes, jede Art von
Kooperation zu unterstützen, die sich mit der Verbreitung der
genannten Prospektionstechniken, aber auch mit der Förderung
der öffentlichen Wahrnehmung ihres Nutzens zur Erfassung und
Erforschung unseres kulturellen Erbes beschäftigt. Bislang
haben sich 50 Partnerinstitutionen (Museen, Denkmalpflege,
Universitäten und Forschungsinstitute) aus 27 Ländern
Europas sowie aus Australien dem Projektkonsortium angeschlossen,
um einerseits ihre Erfahrungen und Expertisen mit einzubringen und
um andererseits auch als Knotenpunkt zur weiteren Verbreitung der
beschriebenen Verfahren zu dienen.
Die Ziele des
ArchaeoLandscapes Projektes sollen durch die Arbeiten in acht
Aktivitätsfeldern (WP1–8) realisiert werden:
- Entwicklung eines sich selbst tragenden ArchaeoLandscapes
Netzwerks
- Einsatz traditioneller und innovativer Methoden zur
Verbreitung von Fernerkundungstechnologien und
landschaftsarchäologischen Studien
- Unterstützung eines europäischen Austauschs von
Personen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissen durch die
Organisation von Projekttreffen, Workshops, Austauschprogrammen
und ähnlichen Aktivitäten
- Unterstützung der Ausbildung in den Bereichen Remote
Sensing und Landschaftsarchäologie durch Kurse für
Lehrende und Studierende und durch die Einrichtung eines
European Master Abschlusses in Remote Sensing and Heritage
Management
- Erweiterung der Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten
existierender Luftbildarchive in Europa und Bekanntmachung ihres
Potentials für die Erforschung des kulturellen Erbes und
für den (Kultur)Landschaftsschutz
- Unterstützung im Bereich Luftbildarchäologie,
Fernerkundung und Landschaftsarchäologie für
Länder, in denen diese Themen bislang in der
Archäologie und Denkmalpflege unterrepräsentiert sind
- Erforschung von Laserscanningverfahren,
Satellitenbildauswertung und anderen modernen
Prospektionsverfahren sowie der Nutzung von (webbasierten)
Geographischen Informationssystemen für Forschung,
Denkmalpflege und öffentliche Bildung
- Bereitstellung von Unterlagen, Handbüchern und
Erfahrungsberichten zur Luftbildarchäologie, Fernerkundung
und Landschaftsarchäologie, besonders im Hinblick auf
Denkmalpflege, Denkmalerhaltung und Denkmalmanagement.
Das Poster
wird einen kurzen Überblick über die genannten
Fernerkundungsverfahren geben und darüber hinaus die
Projektaktivitäten vorstellen, um einen Einblick in das
Projekt, aber auch in die Möglichkeiten der Teilhabe an den
Projektaktivitäten zu geben.
Archäologische Auswertung von
Geoprospektionsdaten am Beispiel zweier römischer
Gutshöfe in Österreich
Florian Mauthner
Auf dem
Poster werden zwei römerzeitliche Anlagen in Österreich
vorgestellt, welche mittels geophysikalischer Prospektion
erforscht wurden. Diese Daten sollen mithilfe von Grundriss- sowie
Größenvergleichen anhand von Literaturvergleichen
ausgewertet werden und soweit möglich, die Strukturen
funktionell und zeitlich zu fassen.
Der erste
dieser Gutshöfe, jener von Antau, besteht aus zwölf
Baustrukturen, welche sich um einen zentralen Hof gruppieren und
woraus sich ein Wohnhaus und sowie mehrere Bauten wirtschaftlicher
Nutzung erkennen lassen. Desweiteren gibt es eine durchaus
interessante Baustruktur mit Säulenstellungen innerhalb einer
Mauer sowie mehrere nicht näher zu definierende Strukturen.
Um die Anlage
zeitlich zu fassen, wurde eine Oberflächenbegehung
durchgeführt, bei welcher hauptsächlich die
Metallobjekte, aber auch Keramik aufgesammelt wurde. Neben dem
Datierungsansatz von 2. bis ins 4. Jh. nach Christus konnte die
Auswertung der Fundverteilung auch Aufschluss über etwaige
Gebäudefunktionen geben.
Der Gutshof
von Zillingtal besitzt neun Bauten, die ebenfalls einen zentralen
Hof umfassen und von einer zum Teil erforschten Umfassungsmauer
eingegrenzt werden. Neben einem architektonisch interessanten
Wohnbau und mehreren hauptsächlich wohl landwirtschaftlich
genutzten Wirtschaftsgebäuden kann hier ein Badegebäude
festgestellt werden.
Eine
zeitliche Einordnung der Anlage vom 2. Jh. bis an den
Übergang vom 4. zum 5. Jh. beruht zum einen auf
architektonischen Merkmalen, andererseits auf den Funden, die im
Lauf der Zeit auf dem Gebiet des Gutshofes aufgesammelt wurden.
Hinzu kommt ein spätantikes Steinplattengrab, das durch eine
Grabung erforscht wurde.
Analyse des merowingerzeitlichen
Gräberfeldes von Bedburg-Königshoven
Irmela Herzog, Elke Nieveler
Bei der
Analyse des merowingerzeitlichen Gräberfeldes von
Bedburg-Königshoven steht die Frage im Vordergrund, in
welchem Verhältnis die 480 Gräber zu der nahe gelegenen
Bestattung des so genannten Herrn von Morken stehen. Dazu ist es
notwendig, die Struktur und soziale Entwicklung der auf dem
Gräberfeld bestattenden Gemeinschaft zu rekonstruieren.
Eine
Grundlage hierfür ist die bereits in den späten 1980er
Jahren erarbeitete Typologie von fränkischen Grabfunden im
Rheinland, die eine feinchronologische Einordnung der Grabbeigaben
erlaubt. Die chronologische Analyse führte vier Datenquellen
in einem GIS zusammen: (1) eine Tabelle mit Daten zu der Grabform;
(2) eine Tabelle mit den Fundtypen und ihrer chronologischen
Einordnung; (3) eine weitere Tabelle, die die Grabbeigaben den
Fundtypen zuordnet und (4) ein mit einem Zeichenprogramm
erstellter Grabungsplan.
Ein erster
Schritt war die Bearbeitung des Grabungsplans, so dass die
kartierten Gräber und die Tabellen mit den Sachdaten in einem
GIS zusammen geführt werden konnten. Nach einer
Fehlerbereinigungsphase erlaubten die GIS-Kartierungen in
kurzer Zeit – trotz des hohen, für Grabfunde dieser
Zeitstellung im Rheinland aber typischen Beraubungsgrades – die
komplexe chronologische Entwicklung des Gräberfeldes in
weiten Teilen zu rekonstruieren. Das Poster zeigt sowohl die
Schwierigkeiten bei der Datenaufbereitung als auch einige
Ergebnisse der Analyse.